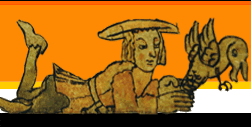
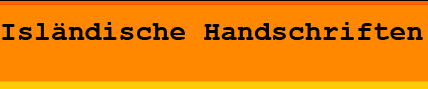
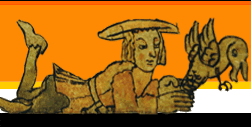 |
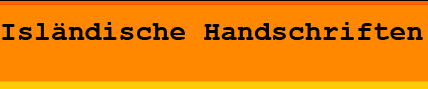 |
Scholastik
Ein Theologiestudium bestand im Mittelalter aus der Lektüre und der Auslegung der lateinischen Fassung der Bibel, die, so setzte man voraus, einen vierfachen Schriftsinn hatte, nämlich historia (buchstäblicher Schriftsinn), allegoria (verborgener Schriftsinn), tropologia (moralischer Schriftsinn) und anagogia (geistiger/spiritueller Schriftsinn). Dies verdeutlicht auch ein lateinischer Vers des Mittelalters:
Littera gesta docet: quid credas allegoria; moralis quid agas; quo tendas angogia
auf Deutsch ausgelegt als:
Der Buchstabe lehrt die Taten, die Allegorie, was man glauben soll, die Moral, was du tun sollst, die Anagogie, wonach du streben sollst.
Bei der Auslegung der Heiligen Schrift stützte man sich auf die Bibelkommentare der Kirchenväter, die allerdings nicht immer miteinander konform gingen. Im 11. und 12. Jahrhundert begann man dann, Methoden griechischer Philosophen wie Platon und Aristoteles auf theologische Fragen anzuwenden, gegensätzliche Deutungen und Ansichten (sententia) zu Einzelheiten oder Fragen (quaestio) zu sammeln, in Zweifelsfällen mit Mitteln der Logik zu einer Entscheidung (determinatio) zu gelangen und diese in systematisch geordneten Werken (summa) darzustellen. So entwickelte sich die scholastische Methode. Deren berühmtester Abkömmling ist die Schriftensammlung "Sententiarum libri quattuor" von Petrus Lombardus, entstanden um 1160, die als theologisches Unterrichtsbuch viele Jahrhunderte hindurch in Gebrauch war. Andere wichtige Vertreter der Scholastik waren z.B. Anselm von Canterbury (etwa 1033-1109) und Thomas von Aquin (etwa 1225-1274).
Die Gründung von Universitäten in Europa
Im 12. Jahrhundert hatte sich die Zahl der Lehrer und Schüler an den Domschulen der größten Städte Westeuropas so vergrößert, dass man begann, von "universitas magistrorum et scolarium", also von "Universität", zu sprechen. Die förmliche Satzung einer Universität wurde vom Papst bestätigt, manche entwickelte sich aber auch „aus der Gewohnheit“ (ex consuetudine). Zum Theologiestudium kam das Studium der Medizin und der Rechte, so dass mehrere Jahrhunderte lang drei Abteilungen an den Universitäten bestanden. Die Philosophie, die vierte, war ursprünglich eine Vorbereitungsabteilung, welche die sieben freien Künste lehrte.
Die ersten europäischen universitären Verbünde entstanden zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert in Italien, Frankreich, England, Spanien und Portugal. Manche der Schulen spezialisierten sich auf ein Gebiet, wie etwa die Rechtsschule in Bologna in Italien (die älteste Hochschule, gegründet 1088) oder die Schule der Medizin in Montpellier in Frankreich (ab 1180, Hochschule ab 1220). Zentrum der Theologie und Philosophie war besonders Paris (ab der Mitte des 12. Jahrhunderts), knapp gefolgt von Oxford (ab dem Ende des 11. Jahrhunderts, Hochschule vom 12. Jahrhundert an).Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert stieg die Zahl der Hochschulen weiter an. Im 14. Jahrhundert wurden u.a. die Universitäten von Prag (1347), Krakau (1364), Wien (1365) und Pécs in Ungarn (1367) gegründet. Damals entstanden auch die ersten Universitäten des heutigen Deutschland, in Erfurt (1379-1806, wiedergegründet 1994), Heidelberg (1385) und Köln (1388). Im 15. Jahrhundert wurden Hochschulen in St. Andrews (1411, Schottland), Rostock (1419), Basel, Leuven (1425, heute Belgien), Greifswald (1456) und Pressburg (1465, Slowakei) gegründet.
Die ältesten Universitäten in Skandinavien entstanden in der Zeit der Kalmarer Union (1397-1524). Damals unterstanden die drei nordischen Königreiche Norwegen, Dänemark und Schweden noch einer gemeinsamen Regierung. Die erste Universität wurde im Jahre 1425 in Lund in Schonen eröffnet (und bestand bis 1536), dem einstigen Sitz des Erzbischofs der Dänen, das aber nun zu Schweden gehört. Die heutige Universität Lund wurde 1666 gegründet, nachdem die Schweden Schonen 1658 von Dänemark erhalten hatten. Die Universität Uppsala in Schweden wurde 1477 gegründet und ist die älteste Universität in Skandinavien. Die Universität in Kopenhagen gibt es seit 1479. Über Jahrhunderte hinweg war sie die Universität des gesamten dänischen Königreiches, einschließlich Norwegens und Islands, die vor der Gründung der Universität von Oslo 1811 (früher: Det Kongelige Frederiks Universitet) und der Universität Islands 1911 keine eigenen Universitäten hatten. Auf Grönland besteht seit 1989 die Universität Ilisimatusarfik, 1990 wurde auch auf den Färöern eine Universität gegründet.